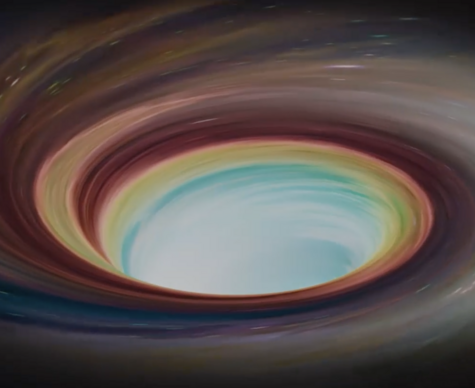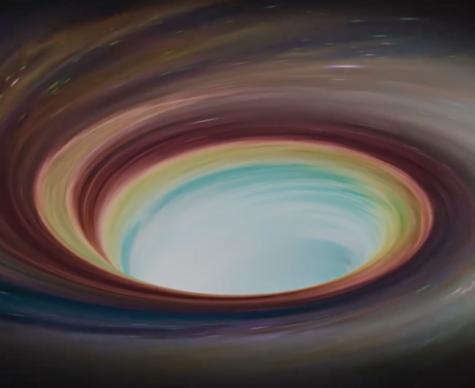Anfang Mai 2020 entwarf ein Video des Bundesgesundheits-ministeriums Strategien für ein Miteinander trotz Distanz. Unter #ZusammenGegenCorona wurden Fragen beantwortet, die im ersten Lockdown exemplarisch zeigen sollten, wie es gemeinsam weitergehen kann. 60 Sekunden montierten ein Bild der Gesellschaft aus Elementen wie “wenn die Sportvereine zu sind”, “wenn die Restaurants geschlossen sind”, “wenn die Schwächeren unter uns bedroht sind” und “wenn Ärzte und Pfleger kaum noch ihre Masken vom Gesicht kriegen” (wobei hier bis zum Wort “Ärzte” ein Mann und danach nur noch Frauen im Bild zu sehen waren). Die Antworten zeigten dazu Heimsport vorm Laptop mit der Workout-Videokonferenz, Essen zum Mitnehmen aus dem Restaurantfenster, Hilfe beim Einkaufen und das solidarische Maskentragen, was sich als vertikal geteiltes Portrait präsentierte: In ihm wurden zwei Köpfen zu einem, indem sich professionelle und alltägliche Maskenträger:innen zu einem neuen Bild ergänzten.
Diese Form von Zusammenhang – der Split Screen, der zugleich verbindet und trennt – war das ästhetische Prinzip dieses Videos. Eine Geste neuer Verhältnisse: Alle Fragen führten dahin, dass zwei, die sich nicht begegnen können, im geteilten Bildschirm zusammenkommen und eine Berührung oder einen Kuss andeuten. Damit wurde eine Bildordnung zum Zeichen des gesamtgesellschaftlichen Zusammenhaltens, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits als Symbol eines (etwas) anderen Zusammenhangs etabliert hatte. Dieser Zusammenhang trug den mythischen Zusatz “digital”. Der geteilte Bildschirm und die Rechtecke der Video-Kacheln waren damals längst zum Symbol der Online-Meetings geworden, die in den nächsten Monaten so omnipräsent werden sollten, dass sie, so der Spiegel im Februar 2021, “inzwischen jeder hasst”.
“Zoom fatigue” ist Ausdruck einer besonderen Erschöpfung durch die ewige (und nicht immer perfekte) Wiederkehr des Immergleichen: Interfaces, die als Gebrauchs-Oberflächen konfrontieren und als unsichtbare Beziehungen zwischen Software und Hardware funktionieren.
Schon im Frühling des ersten Corona-Jahres liefen hierzu öffentliche Segnungen und private wie auch publizierte Klagen fast gleichzeitig. Nur kurz nach den euphorischen Technobeschwörungen – “Das Digitale hält uns jetzt zusammen. […] Das Digitale, von Kulturpessimisten und Fortschrittsskeptikern als Hort der menschlichen Entfremdung verfemt, hält Arbeitsprozesse, die Möglichkeit zu lernen und soziale Interaktion aufrecht.” (Die Welt) – setzten die mahnenden Reaktionen ein. Sie betrafen insbesondere die allgegenwärtigen Videokonferenzen. Schlagzeilen hießen “Why Zoom Is Terrible” (New York Times), “Warum uns Videokonferenzen auslaugen” (Handelsblatt) und “‘Zoom fatigue’ is taxing the brain” (National Geographic). Wenngleich Segen und Fluch auch all die anderen Dienste wie z.B. Skype, Microsoft Teams, Jitsy oder BigBlueButton meinte, wurde Zoom – der Shootingstar unter diesen Plattformen, auch bekannt durch “Zoom University” und “Zoom bombing” – zum Synonym für Videokonferenzen. Der Name ist Programm.
Was als “Zoom fatigue” bis heute eine weitverbreitete Diagnose ist, beschreibt Zustände der neuen Monitornormalität geteilter Begegnungen: “the tiredness, worry, or burnout associated with overusing virtual platforms of communication” (Jena Lee). Dieses Phänomen ist jedoch mehr als ein Oberflächeneffekt oder Kommunikationsschaden. Bei “Zoom fatigue” zwingt uns die Begrenztheit der audiovisuellen Kacheln einerseits zu größerer (und oft vergeblicher) Anstrengung, um nonverbale Hinweise wie Gesichtsausdrücke, Körpersprache und Tonfälle auszumachen. Andererseits sorgen gleichzeitig Störungen und Verzögerungen von Datenverarbeitung und Datentransfer – teils kaum bewusst wahrnehmbar – für Artefakte, asynchrone Verhältnisse und weitere Irritationen. Das intensiviert den erschöpfenden Prozess, sinnlich zu verarbeiten, was die Maschinen verarbeitet haben. “Our minds are together when our bodies feel we’re not.” (Gianpiero Petriglieri)
Dieser Distanzeffekt hängt also keineswegs nur mit dem notorischen User-Interface der Rasterordnung zusammen, in dem mich die Videostreams meiner vielen Anderen erreichen. Gleichzeitig wirken dabei, wie immer, andere Interface-Prozesse – leitende Relationen von Software und Hardware, die als Basis aller Bildschirm- und Lautsprecher-Effekte dafür sorgen, dass sich Computer im Internet verbinden, die Daten fließen und für meine Augen und Ohren aufbereitet werden. “Zoom fatigue” ist Ausdruck einer besonderen Erschöpfung durch die ewige (und nicht immer perfekte) Wiederkehr des Immergleichen: Interfaces, die als Gebrauchs-Oberflächen konfrontieren und als unsichtbare Beziehungen zwischen Software und Hardware funktionieren.
In unserer Abhängigkeit von Online-Meetings zeigt sich deren Abhängigkeit von den Bedingungen und Prozessen, die Computer und ihre Netzwerke laufen lassen.
Worauf die Effekte und Debatten der plattformübergreifenden Ermüdungserscheinungen hinweisen, ist darum jener Zusammenhang, der hinter dem mythischen Versprechen “des Digitalen” steckt, das nun alles “aufrecht” halten soll. Das hier ist nicht einfach “Telepräsenz”. Was hier körperlich spürbar und Gegenstand von Berichten wird, ist die Prozessualität und Materialität vernetzter Computer, die als Technologie nun nicht mehr nur magisch effektiv (It just works) wirkt. Nun – im Modus der Störung mit körperlichen Folgen – drängt sich auf, was ansonsten unter dem Radar menschlicher Wahrnehmung schlicht funktionieren soll. In unserer Abhängigkeit von Online-Meetings zeigt sich deren Abhängigkeit von den Bedingungen und Prozessen, die Computer und ihre Netzwerke laufen lassen.
Die Gegenwart dieser Gemeinschaftserschöpfung ist damit die derzeit vielleicht drängendste Erinnerung daran, dass jeder menschliche Austausch über Online-Plattformen eben zuallererst ein Datenaustausch ist. Er hat eigene, streng formalisierte Regeln, deren Abläufe Fragen des Datenschutzes und der Datenökonomie gleichermaßen betreffen. Er ist Produkt von Programmen, von immer schon ausgeführten (und darum hackbaren) Anweisungen, die von jeder Menge Hardware ins Werk gesetzt werden. Und er braucht darum eine Infrastruktur, deren Rohstoffe sowie Energie- und Wasserverbrauch ebenso ins Gewicht fallen wie der Elektroschrott, der vorzugsweise in den globalen Süden abgeschoben wird.
Jede Form dessen, wie wir online zusammenkommen (mit oder ohne Kachel-Raster), bleibt davon abhängig. Diese Beziehungen sind immer programmatisch: Programmatisch nicht nur, indem sie richtungsweisend wirken und auf Standards einer neuen Normalität deuten mögen. Link or you’ll miss it. Programmatisch sind sie vor allem, weil sie auf der Programmierbarkeit von Computern beruhen und konkrete Programme mit Hardware realisieren. Wie wir zusammenkommen können, hat die Programmierung in jedem Fall (so und nichts anders) exakt festgelegt. Vorschrift befiehlt, wir folgen. Auch daran erinnert die “Zoom fatigue”-Kritik an den beharrlichen Bedingungen der User-Interfaces.
Die Vernetzung und Eigendynamik von Computern, die unter dem Schlagwort “die Digitalisierung” läuft, hat nicht zuletzt den großen Vorteil, Gemeinschaften zu bilden, die Grenzen und Distanzen überwinden. Das macht sie – in Gestalt von Internet-Diensten – gerade angesichts der Pandemie so wertvoll und erklärt auch die Split-Screen-Antworten des Ministeriums. Neben den zahlreichen Folgen, die dazu seit Jahren intensiv diskutiert werden (von eincodierten Vorurteilen über Filterblasen und Surveillance/Capture Capitalism bis zur algorithmischen Gouvernementalität durch KI), rücken die “Zoom fatigue”-Effekte und -Debatten die Bedingungen dieser programmatischen Beziehungen in den Vordergrund. Etwas davon wird spürbar – und mag so einfach auch daran erinnern, mit was für einer Vernetzung wir es beim Internet eigentlich zu tun haben.
Wie wir zusammenkommen können, hat die Programmierung in jedem Fall (so und nichts anders) exakt festgelegt. Vorschrift befiehlt, wir folgen.
Unsere Gemeinschaft, die wir dadurch eingehen, ist eine vorschriftsgemäße Gemeinschaft von Menschen und Maschinen gleichermaßen. Davon hatte der 2010er-Hype vom “Internet of Things” ja ganz erfolgreich abgelenkt; als ob das Internet zuvor eines der Körper gewesen wäre. Diese Gemeinschaft muss immer auch die von und mit Dingen sein, und die Summe der Kabel, Funkmasten und Computer in diesem Zusammensein wächst permanent, weil schon für unsere zunehmenden Online-Dienste von Streaming, Clouds, Zoom & Co so viel mehr Computer in Serverparks gebaucht werden als jene, die wir dabei in Händen, auf dem Schreibtisch oder neben der Yogamatte haben.
Die programmatischen Beziehungen, die wir dabei eingehen, sind global und planetarisch. Sie brauchen und betreffen mehr Teile der Welt als nur jene Menschen, mit denen wir dabei in distanzierten Kontakt kommen. Die “Zoom fatigue”-Sensibilität für diese Beziehungen kann darum auch über die ureigenen Empfindungen hinaus für die Bedingungen und Nebenwirkungen einer Technologie sensibilisieren, die nie nur uns zusammenhält.